Mythos Rauchsäule – ein Relikt aus der Vergangenheit

In der Begutachtung von Fahrzeugschäden infolge von Bränden im Freien hält sich hartnäckig ein Irrglaube: Die vermeintlich ausschlaggebende Bedeutung der „Rauchsäule“ zur Beurteilung der Schadstoffverteilung. Diese Vorstellung, häufig mit Berufung auf Windrichtung und sichtbare Rauchentwicklung argumentiert, ist jedoch weder physikalisch korrekt noch fachlich belastbar. Sie beruht auf überholten Annahmen aus den 1970er Jahre und widerspricht sämtlichen strömungsphysikalischen Grundlagen.
Die Theorie, dass nur Fahrzeuge „in Windrichtung“ oder „unter der Rauchsäule“ betroffen seien, stammt aus einer Zeit, in der Schadensregulierung stärker von Interessenlagen als von wissenschaftlichen Erkenntnissen geprägt war. Die Praxis, zur Schadensbeurteilung pauschal das Wetteramt zu konsultieren, führte dazu, dass Schadensmeldungen bei „falscher“ Windrichtung regelmäßig abgelehnt wurden – unabhängig von der tatsächlichen Expositionslage.
Die entscheidende physikalische Kraft bei Bränden im Freien ist die thermisch induzierte Konvektionsströmung. Sie entsteht unmittelbar nach Zündung und führt zu einer radialen, bodennahen Verlagerung der gasförmigen Verbrennungsprodukte – mit hoher Geschwindigkeit und völlig unabhängig von der Windrichtung. Die thermische Druckwelle breitet sich konzentrisch um das brennende Objekt aus und erfasst innerhalb kürzester Zeit ein Areal von mehreren Hundert Metern.
Diese Art der Ausbreitung wurde durch zahlreiche Feldstudien und Modellversuche nachgewiesen – unter anderem durch Langzeitprojekte zur Bestimmung realer Kontaminationsradien. Die typische Reichweite toxischer Brandgase liegt demnach bei bis zu 1200 Metern. Diese sogenannte 1200-Meter-Regel ist heute von Gerichten, Behörden und Fachkreisen anerkannt und wird als Grundlage zur Gefahrenzonierung herangezogen.
Bei der Verbrennung eines Kraftfahrzeugs entsteht eine komplexe Mixtur toxischer Gase, unter anderem:
- Polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK),
- Dioxine und Furane,
- chlororganische Verbindungen.
Aufgrund der bekannten physikalischen Gesetzmäßigkeiten und der Vielzahl dokumentierter Schadensfälle ist es nicht erforderlich, jedes Fahrzeug im 1200-Meter-Radius individuell zu untersuchen. Vielmehr gilt: Innerhalb dieses Radius ist grundsätzlich von einer technischen und gesundheitlich relevanten Kontamination auszugehen – unabhängig davon, ob sichtbare Rückstände vorhanden sind.
Einzelmessungen – etwa durch Luftanalytik oder Innenraumproben – sind in diesen Fällen nicht wirtschaftlich vertretbar und auch nicht fachlich erforderlich. Die Kosten solcher Messungen (i. d. R. 1500–5000 € netto) übersteigen regelmäßig den Aufwand der sachgerechten Dekontamination.
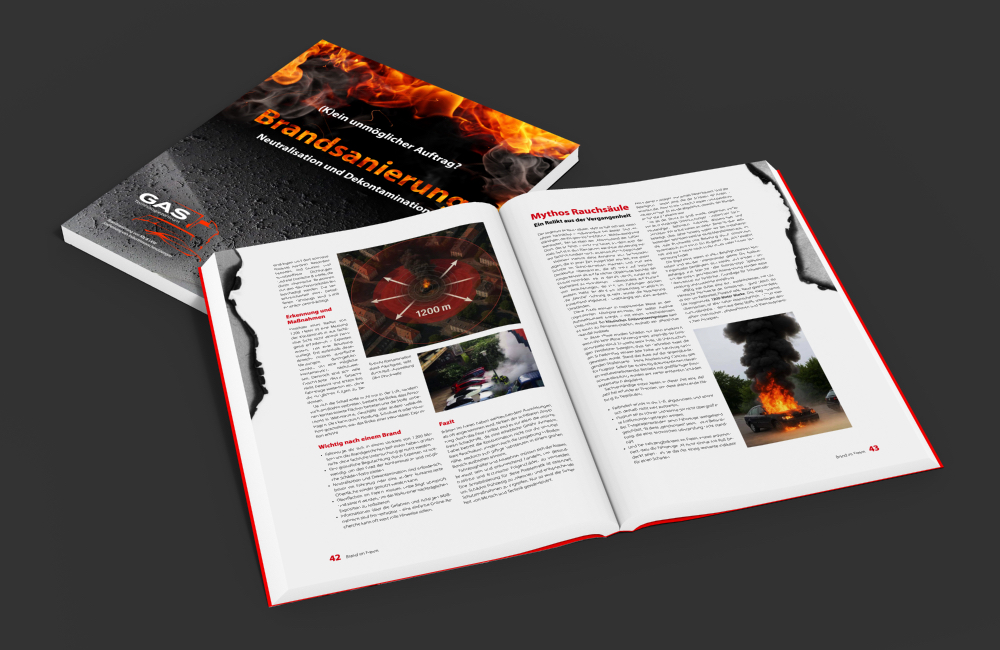
Fazit: Die Vorstellung, dass sich Schadstoffe ausschließlich entlang der optisch sichtbaren Rauchsäule ausbreiten, ist ein fachlicher Trugschluss. Sie ignoriert die grundlegenden Prinzipien thermischer Strömung und führt zu systematischen Fehleinschätzungen. Sachverständige sind daher gefordert, sich an wissenschaftlich gesicherten Erkenntnissen zu orientieren – und nicht an tradierten Lehrmeinungen.
Wer in der Bewertung von Fahrzeugschäden infolge von Bränden weiterhin auf die „Rauchsäule“ rekurriert, verlässt den Boden der Physik – und läuft Gefahr, objektiv relevante Schäden zu übersehen oder falsch zu bewerten.
Den ausführlichen Fachtext (Auszug aus dem Fachbuch: Kein unmöglicher Auftrag: Brandsanierung – Dekontamination / Neutralisation) finden Sie unter der Rubrik TOP-Themen.